Gaea Schoeters: Das Geschenk
Besprechung
Der Roman beginnt mit der Schilderung einer nahezu idyllischen Szene eines Elefanten, der bei Sonnenaufgang an einem Flussufer trinkt. Im weiteren Verlauf wird der Kontext der Szene klarer: Ein Berliner Obdachloser beobachtet einen sich badenden Elefantenbullen mitten in der Spree. Schnell verbreitet sich die unglaubliche Nachricht in der Bevölkerung. In den Fokus der Narration gerät Hans Christian Winkler, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der versucht, der unklaren Lage Herr zu werden. Nach und nach werden die verschiedenen Optionen (Terroranschlag mit ferngesteuerten Tieren, Zooausbruch, Spionage) durch den einberufenen Krisenstab besprochen. Verschiedene Optionen werden geprüft; Kompetenzschwierigkeiten erschweren die Abstimmungen. Gleichzeitig erhöht sich der Druck auf die Politiker, da immer mehr Tiere in Berlin gesichtet werden, die eine sichtbare Spur der Verwüstung hinterlassen und auf der Suche nach Nahrung Supermärkte plündern. Die Erklärung erfolgt nach einem Telefonat mit dem Präsidenten von Botswana: Aufgrund des durch den Westen eingeforderten Tierschutzes kommt es dort zu einer Überpopulation an Elefanten, die den Menschen die Lebensgrundlagen nehmen. Präsident Tebogos Urteil ist hart: „Ihr Europäer wollt uns vorschreiben, wie wir zu leben haben. Vielleicht solltet ihr einfach mal selbst versuchen, mit Megafauna zurechtzukommen.” Aus diesem Grund schenkt er der Bundesrepublik 20.000 Elefanten, mit denen die Deutschen artgerecht umgehen müssen.
Bundeskanzler Winkler und seine Koalition sind nun im absoluten Krisenmodus und versuchen, mit einem Bewachungs- und Fütterungsplan sowie einer Imagekampagne die Elefanten als positive Deutschland-Maskottchen zu vermarkten. Nach achtzig Tagen werden jedoch populistische politische Stimmen immer lauter, die die Klagen und immer massiver werdenden Proteste der Bevölkerung aufnehmen und fordern, Menschenrecht über den Tierschutz zu stellen. Die Ausscheidungen der Elefanten stinken nicht nur, sie enthalten auch invasive Arten, die die ganze Stadt überwuchern, und sorgen dafür, dass Deutschland die Emmissionsgrenzen überschreitet und Zertifikate bei Botswana kaufen muss. Nach einhundert Tagen ist Winkler so ratlos, dass er seine Amtsvorgängerin um Rat bittet. Der Bundeskanzler greift ihren Ratschlag auf, eine Regierungsbeauftragte für Elefantenangelegenheiten zu bestimmen. Die neue Ministerin Hannelore Hartmann wirbt für ein Umsiedlungsprogramm der Elefanten auf alle 16 Bundesländer. Eine weitere große Herausforderung stellen die explodierenden Kosten dar. Mit einer speziellen Behandlungsmethode soll der Elefantenkot in Dünger umgewandelt und dann verkauft werden. Dieser Düngermix erobert zwar in kürzester Zeit die europäischen Märkte, durch unvorsichtige Handhabe bei der Produktion sind jedoch Rückstände von wilden Samen in den Mix geraten, was zu einem enormen Vormarsch von Kletterpflanzen und Schadensersatzforderungen auch aus dem Ausland führt. Eine Massenkarambolage zwischen einer Elefantenherde und PKWs auf einer Autobahn führt das ganze Dilemma vor Augen: Die schwer verletzte Elefantenkuh wird von den anderen Elefanten derart bewacht, dass man weder an sie herankommt noch an die 70 schwer verletzten Autofahrer.
Da die Gesamtsituation immer unhaltbarer wird, schlägt Winkler schließlich einen Drittstaatendeal vor: Die Elefanten sollen in ihr natürliches Habitat reintegriert werden. Wenn Deutschland dafür bezahlt, wäre Ruanda dazu bereit. Hartmann sieht hingegen in der Elefantenkrise eine Chance für mehr Biodiversität, um in der Klimakrise zu überleben. Am Ende setzt sich Winkler zwar durch, für seine Entscheidung muss aber ein hoher Preis gezahlt werden.
Didaktische Hinweise
Wie in Schoeters Erzählung „Trophäe” beginnt die Narration mit einer kontextlosen Situation bzw. stellt sich der Kontext, den sich die Lesenden aufgrund der wenigen Informationen erschließen, zunächst als unvollständig bzw. falsch heraus. Insofern stellt die Beschäftigung mit den erzählerischen Mitteln, mit denen angedeutet wird, dass sich der Elefant, der in der ersten Szene am Flussufer steht, nicht in seiner natürlichen Umgebung befindet, eine wichtige interpretatorische Aufgabe dar.
Interessant ist die unterrichtliche Verfolgung der Deutungshypothese, dass die Elefanten nur stellvertretend für ein anderes politisches Problem stehen. Wie der „Elefant im Raum”, unausgesprochen, aber für jeden klar, liegt die Vermutung nahe, dass es hier um die Behandlung der Flüchtlingskrise geht. Im Text gibt es zahlreiche Anspielungen, die diese Sichtweise nahelegen: der ungeregelte Zustrom, der Streit um die gerechte Verteilung der Elefanten, die wechselnde Stimmung in der Bevölkerung (Willkommenskultur vs. Abschiebung), die Rede von der Drittstaatenregelung und der Reintegration, die Parolen der Populisten, die Ängste in der Bevölkerung schüren, der Hinweis der ehemaligen Bundeskanzlerin (!), mit einem einfachen „Wir schaffen das” sei es nicht getan etc.
„Elefanten sind keine Flüchtlinge”, ermahnt ihn die Amtsvorgängerin und auch Hartmann wirft dies dem Bundeskanzler vor. Diese wiederholte Feststellung versperrt also eine zu einfache Lesart und lädt zu einer kritischen Überprüfung der oben genannten Deutungshypothese ein.
Den Kanzler zu charakterisieren und Winkler als private und als politische Person vorzustellen, stellt eine weitere lohnende Beschäftigung mit der Erzählung dar.
Der Verweis zu Schoeters Bestseller „Trophäe” liegt auf der Hand, denn schließlich argumentiert der Präsident von Botswana damit, dass seinem Staat Millionen entgehen, wenn die Trophäenjäger aufgrund der Tierschutzgesetze ausbleiben und so die Wilderei zunimmt. In diesem Zusammenhang ist die Bezeichnung des letzten Kapitels als „Verrat” aufschlussreich: Schlussendlich setzt sich Winkler mit seinem Drittstaatendeal durch und wird wiedergewählt. Der Drittstaat Ruanda gibt seinen Jägern allerdings die Elefanten als Trophäen zum Abschuss frei.
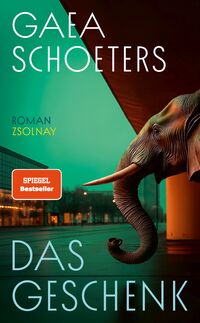
Gattung
- Romane
Eignung
sehr gut als Klassenlektüre geeignetAltersempfehlung
Jgst. 10 bis 13Fächer
- Deutsch
- Sozialkunde/Politik und Gesellschaft
FÜZ
- Politische Bildung
- Werteerziehung
- Interkulturelle Bildung
Erscheinungsjahr
2025ISBN
9783552075740Umfang
135 SeitenMedien
- Buch
- Hörbuch
- E-Book


